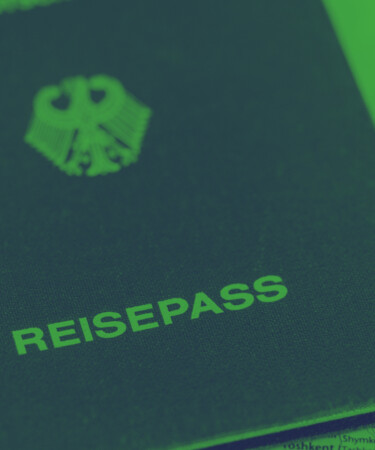
Deutscher Pass darf nicht vom Einkommen abhängen: GFF klagt für gleiches Einbürgerungsrecht
Wer auf Dauer in Deutschland lebt, muss einen realistischen Weg zur Staatsbürgerschaft haben. Den hat eine Gesetzesänderung für viele Menschen mit Behinderung und alte Menschen blockiert. Dagegen ziehen wir vor Gericht.
Der Mann und die Frau aus Palästina haben nach ihrer Ankunft in Deutschland 2015 Integrationskurse absolviert, Deutsch gelernt, gearbeitet und sich sozial engagiert. Inzwischen sind sie aufgrund ihres Alters und von Erkrankungen auf Unterstützung angewiesen. Dass die Behörden alte Menschen mit Behinderung vom Anspruch auf Einbürgerung ausschließen, verstößt aus unserer Sicht gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Verbindung mit dem Demokratieprinzip, das Diskriminierungsverbot und den allgemeinen Gleichheitssatz.
Der Mann und die Frau aus Palästina gelten in Deutschland als staatenlos, sind im Rentenalter und auf absehbare Zeit auf existenzsichernde Leistungen angewiesen. Beide haben Erkrankungen und die Feststellung einer Behinderung beantragt. Das macht sie zu besonders vulnerablen Personen. Auch sie müssen die Möglichkeit haben, an der deutschen Demokratie teilzuhaben und repräsentiert zu sein. Vor Gericht vertritt die Kläger*innen der Rechtsanwalt Dr. Adrian Klein.
Seit 2024 gewährt das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) keinen Anspruch auf Einbürgerung mehr, wenn Menschen Leistungen zur Existenzsicherung beziehen. Davor gab es eine Ausnahmeregelung für Ausländer*innen, die auf solche Leistungen angewiesen waren, ohne dass sie selbst etwas dafürkonnten. Darunter fielen Alleinerziehende, Studierende, Rentner*innen, Menschen mit Behinderung – wie im Fall des Ehepaares. Eine solche Ausnahme-Regelung ist auch heute nötig, um nicht systematisch Gruppen von Menschen zu diskriminieren, die ihren Lebensunterhalt ohne eigenes Verschulden nicht oder nicht ganz selbst bestreiten können. Das Staatsangehörigkeit soll derzeit wieder reformiert werden. Die zuständigen Ausschüsse des Bundesrats haben bereits empfohlen, die Ausnahmeregelung wieder einzuführen.
In Deutschland sind Einbürgerungen im Wesentlichen auf zwei Wegen möglich: Ausländer*innen, die alle Voraussetzungen für die Einbürgerung erfüllen, haben nach § 10 StAG einen Anspruch, dem die Behörden nachkommen müssen. Seit der Reform von 2024 fallen viele Fälle in den Bereich der sogenannten Ermessenseinbürgerung (§ 8 StAG), aus der sich aufgrund der grundrechtlichen Relevanz in bestimmten Fällen ebenfalls ein Anspruch ergeben muss. Dabei ist auch die Staatenlosigkeit des Ehepaares aus Palästina zu berücksichtigen. Eine gerichtliche Klärung, ob und wann ein Anspruch auch nach § 8 StAG besteht, ist überfällig. Wer dauerhaft in Deutschland lebt, muss bei Wahlen abstimmen dürfen und durch Zugang zu Ämtern repräsentiert werden. Das gilt ganz besonders für vulnerable Personengruppen, die eine starke Stimme brauchen.
Unmittelbar betroffen sind neben Menschen, die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen, auch alle, die Partner*innen oder Angehörige pflegen. Wer ohne Trauschein oder Lebenspartnerschaft Fürsorgeverantwortung übernimmt und deshalb Unterstützung bekommt, fällt durch das reformierte Gesetz demnach aus dem Anspruch auf Einbürgerung heraus. Der Ausschluss vulnerabler Gruppen wurde auch von vielen Verbänden und Sachverständigen im Gesetzgebungsprozess kritisiert.





